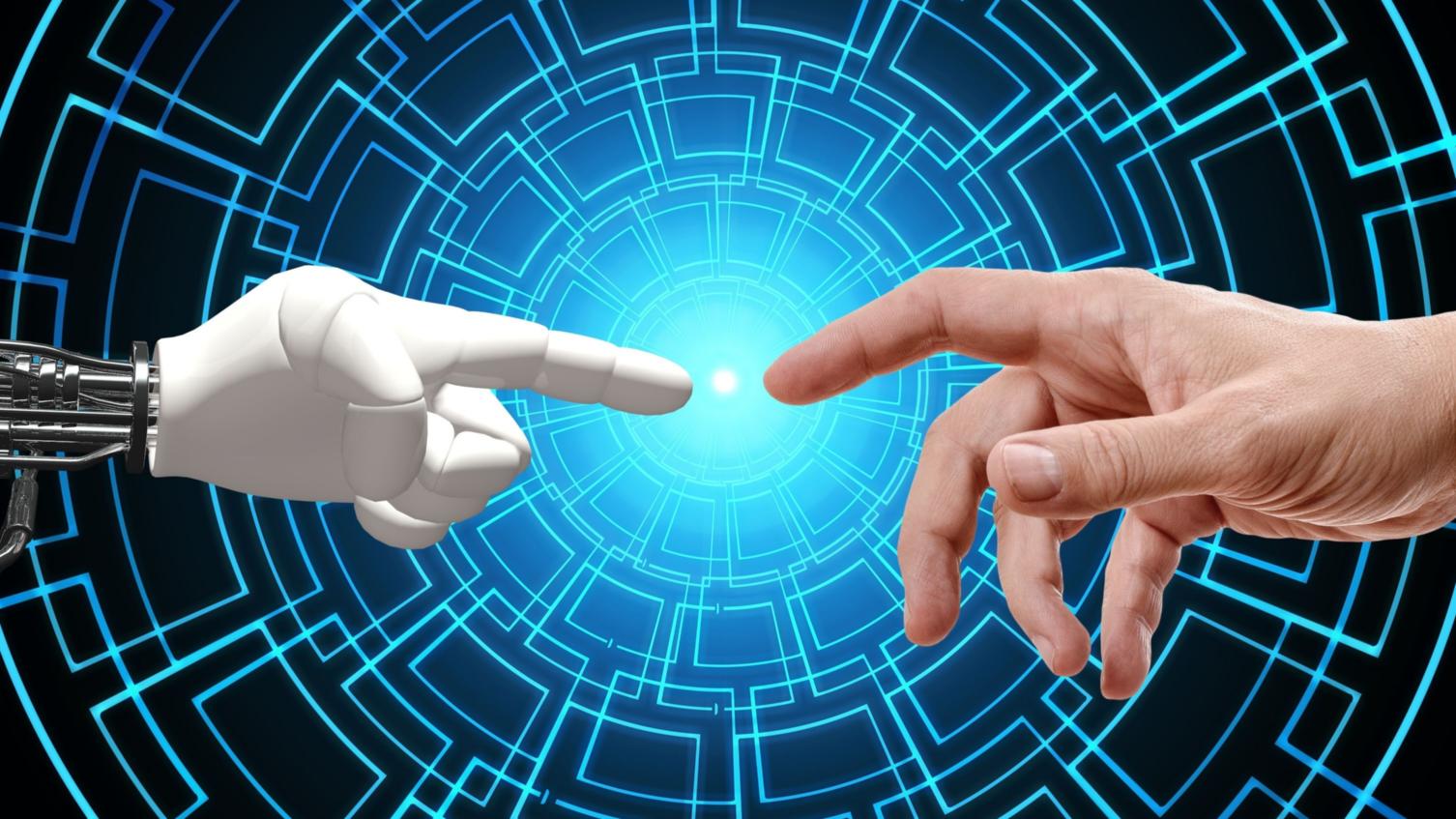Wie wollen wir leben?
Künstliche Intelligenz macht sich überall breit. Die gesellschaftliche Debatte hinkt hinterher
Die technologische und ökonomische Dynamik hängt allerdings die gesellschaftliche Debatte über Chancen und Risiken ab. Die Zeit drängt, über ethische Leitplanken für Entwicklung und Einsatz der KI zu reden.
Auf dieses Ziel konzentrierte sich die 4. Dialogtagung „Kirche und Wirtschaft“ am 26. Juni. 130 Frauen und Männer folgten der Einladung von Bistum und Domkapitel Aachen in die anregende Umgebung der „Digital Church“, einem digitalen Gründerzentrum in der ehemaligen Kirche St. Elisabeth am Aachener Blücherplatz. Wo tagsüber junge Existenzgründer mit kleinen und mittleren Unternehmen Konzepte entwickeln, wie sich Dinge digitalisieren lassen, versammelten sich nun am Abend Leute, die digitale Veränderungen ethisch ausgestalten möchten. Stefan Wrobel leitet ein Fraunhofer-Institut in Bonn. Er vermittelte in Aachen Hintergründe zum Siegeszug der Technologie. Künstliche Intelligenz entwickele sich so dynamisch, weil inzwischen nicht nur die passenden Algorithmen gefunden wurden und die technische Leistungsfähigkeit der Maschinen gewachsen sei, sondern auch die Kunden bereitwillig mithülfen, die Datenbasis für KI zu verbessern. Denn ohne Daten ist alles nichts, sie sind der Treibstoff, auf dem Maschinen sich eigenständig in ihren Lösungsstrategien weiterentwickeln. Ob es soziale Netzwerke sind, Daten, die Websites oder Apps einholen, Daten bei Unternehmen und Behörden – aus allem lassen sich Zusammenhänge herstellen, statistische Wahrscheinlichkeiten und Prognosen benennen, Entscheidungen ableiten.
Der Ansatz der KI sei, das eigenständig zu tun und dabei stetig weiterzulernen. Wrobel verdeutlichte, dass die technologische Entwicklung in immer mehr Bereichen den Menschen ähnlich, ihn ersetzen oder auch übertreffen wird. Dass die Maschine inzwischen bei Strategiespielen wie Schach und Go Meister ist, ist noch zu verschmerzen. Aber wenn dadurch Arbeitsplätze substituiert werden, etwa durch selbst fahrende LKW, durch präzise medizinische Diagnose, durch eigenständige Auswertung von Texten aller Art, durch intelligente Gesprächsführung? Der Wandel erfasse alle Branchen, betonte Wrobel. Mit dieser Perspektive sei es zwingend, sich nicht nur über technische Aspekte zu unterhalten. Große Fragen tun sich auf: Wie reagieren Wirtschaft und Gesellschaft auf die Veränderungen? Wie behalten sie die Kontrolle über schützenswerte Daten und über Entscheidungen der Maschinen? Der Druck, sich über ethische und praktische Leitplanken zu verständigen, wächst mit der nahenden Einführung des Internets der Dinge erheblich.
Dieses wird die Erfassung und Verarbeitung von Daten vervielfältigen – mit allen Folgen, die eine vernetzte Auswertung mit sich bringt. Wrobel zeigte sich froh, an diesem Abend einen solchen Diskurs mitgestalten zu können. Bei Fachtagungen würden zwar ethische Aspekte gestreift, aber man gehe gleich zum Tagesgeschäft über. Die Zeit dränge. Zwar könne man vieles, was KI bewirke, auch ohne Ethik-Richtlinien zulassen, etwa die Steuerung von industriellen Fertigungsanlagen. Anderes aber bedürfe ethischer Vorgaben, etwa im Versicherungswesen, wo das Prinzip der Solidarität unter Druck gerate.
Die KI ist kein rein akademisches Thema, sondern greift tief in unser Leben ein
Generalvikar Andreas Frick griff die Fäden auf, die Stefan Wrobel gesponnen hatte. Der Mensch sei seit jeher technologieabhängig, müsse aber vor seinem Tunnelblick auf die Vorteile und Bequemlichkeit der neuen Technologien geschützt werden. Frick fragte nach dem richtigen Korrektiv in dem Innovationsprozess und sah es eher in den Zehn Geboten als in Regeln, die sich Konzerne selbst setzen. Schwächere und Zahlungsunfähige dürften nicht unter die Räder geraten. In Kleingruppen vertieften die 130 Gäste die Chancen und Risiken des Wandels und wie er sich angemessen gestalten lässt.
Denn letztlich geht es um eine wichtige Frage, wie Joachim Söder von der Katholischen Hochschule NRW in Aachen sagte: In welcher Welt wollen wir leben? Einsatzgebiete der KI wie autonome Kampfroboter oder großflächige Überwachungsinfrastruktur zeigen, dass dies keine rein akademische, sondern eine sehr konkrete Frage ist, die tief in unser Zusammenleben eingreift. Keineswegs geht es um eine Vermeidung der technologischen Entwicklung, sondern um deren Gestaltung. Die Chancen, die darin liegen, um besser zu leben und zu arbeiten, sind gar nicht so gering.
Der Abend zeigte: Die Fragen, welche die KI aufwirft, dürfen nicht an Konzerne und Kommissionen, nicht an Politiker und Programmierer delegiert werden. Es bedarf eines stetigen Austausches auf allen Ebenen, möglichst interdisziplinär, kooperativ, inspiriert. Als Orte für einen solchen Austausch bieten sich Ideenschmieden wie die „Digital Church“ an. Aber auch die Kirche hat hier viel zu bieten, in Aachen etwa mit dem Hochschulzentrum Quellpunkt auf dem Campus Melaten.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie sehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz? Sehen Sie eher Chancen oder eher Risiken? Was erhoffen Sie sich, was fürchten Sie? Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an: kirchenzeitung@einhardverlag.de