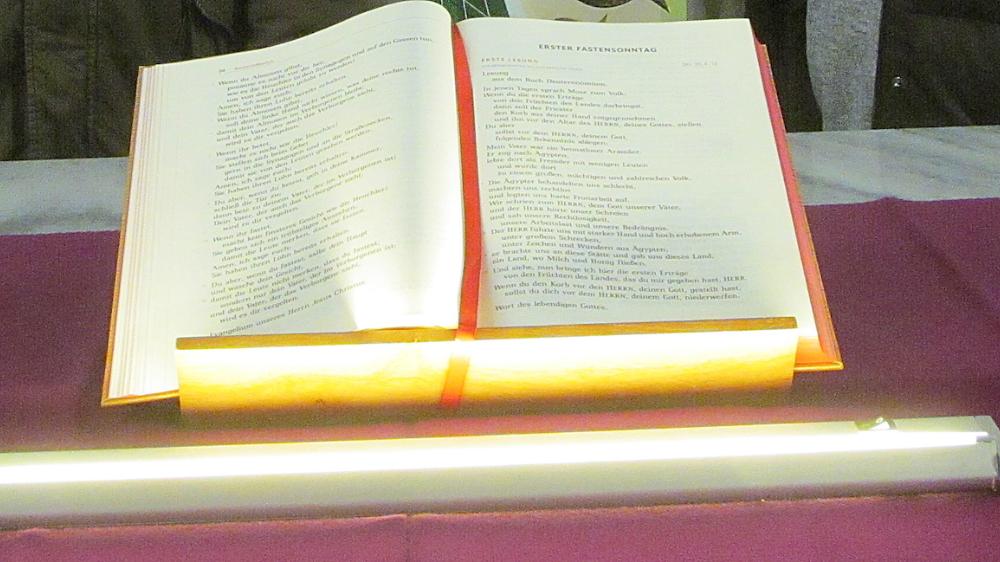„Mit Patienten durch Höhen und Tiefen gegangen“
Krankenhausseelsorge und Krankenkommunionhilfe in Corona-Zeiten: eine persönliche Bilanz
Vor besondere Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ist auch die Krankenhausseelsorge gestellt worden. „Niemand wusste anfangs, wie es geht und weitergeht. Aber inzwischen sieht das Gott sei Dank wieder ganz anders aus, und wir haben Wege gefunden, um wieder nahe bei den Menschen zu sein“, sagt Pastoralreferentin Helena Fothen, Krankenhausseelsorgerin der Katholischen Nordkreiskliniken.
Wütend und traurig habe die Corona-Zeit sie gemacht, räumt die offene, bodenständige Seelsorgerin ein. In der Krankenhausseelsorge sei die Anzahl der Besuche zeitweise zurückgegangen, habe aber anders stattgefunden. Ab dem ersten Lockdown vor zwei Jahren hätten die sonst üblichen Angebote wie Literaturabende, Konzerte für die Geriatrie- und Demenzabteilungen und die Gottesdienste mit viel Musik, die auf den Stationen stattgefunden haben und dorthin übertragen wurden, ausfallen müssen. Ein viel größerer Einschnitt aber war, dass die Patienten auf den Stationen nicht mehr besucht werden konnten und total abgeschottet wurden, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.
Auch Helena Fothen durfte Patienten anfangs nicht mehr aufsuchen. „In dieser Zeit, als wir alle völlig hilflos waren, hat es ganz tragische Fälle gegeben“, räumt die Pastoralreferentin ein. „Die Bezugspersonen, das gewohnte Pflegepersonal, der soziale Dienst und auch ich konnten die Menschen nicht mehr aufsuchen. Insofern sind manche allein gestorben. Aber das Personal war immer da.“ Helena Fothen erinnert sich daran, dass etwa ein alter Mann seine Ehefrau, mit der er viele Jahre verheiratet war, nicht besuchen konnte; auch meldete sich eine jüngere Frau bei ihr, die den Gedanken nicht ertragen konnte, dass ihr Vater ohne das Beisein der Familie gestorben war. Die Situation sei zudem noch dadurch zugespitzt worden, dass ein Großteil des Personals des Linnicher Krankenhauses zeitweise erkrankt sei und deshalb habe ausgewechselt werden müssen.
Nach dem ersten Lockdown wurden die Vorgaben am Linnicher Krankenhaus vorsichtig gelockert und bei den Patientenbesuchen „unter Vorbehalt“ erste Ausnahmen gemacht: Sterbende und lebensgefährlich Erkrankte durften unter den geltenden Auflagen besucht werden. Die Krankenhausseelsorge wurde zum Teil zur Telefonseelsorge umfunktioniert, wobei die Verbindung über das Personal hergestellt wurde. Die Seelsorgegespräche per Telefon liefen schleppend an. Helena Fothen: „Am Anfang gab es noch nicht einmal einen Ratsuchenden pro Monat.“ Aber das sollte sich schon bald radikal ändern, und die Krankenhausseelsorgerin wurde auf diese ungewöhnliche Weise von bestimmten Patienten jeden Tag und sogar am Wochenende vielfach angefragt.
„Ich bin mit den Ratsuchenden durch Höhen und Tiefen mitgegangen, auch wenn die Beratung und Begleitung am Telefon nicht mit der in Präsenz zu vergleichen ist“, unterstreicht Fothen, die zudem im Dezember 2020 selbst schwer an Covid-19 erkrankte, nach wenigen Wochen aber in ihren Dienst zurückkehren konnte. Zu den kirchlichen Hochfesten waren im Jahr 2021 wieder Gottesdienste erlaubt, allerdings bei verschlossener Kapellen-Tür. „Ich erinnere mich noch, dass ich die Osterkerzen und den Adventskranz allein eingesegnet habe“, fügt die Pastoralreferentin hinzu. Durften zunächst zehn Gläubige die Gottesdienste auf Abstand mitfeiern, so sind aktuell 15 erlaubt – in einer Kapelle, die normalerweise 80 Leuten Platz bietet.
Der Kontakt zueinander wurde in einer Whatsapp-Gruppe gehalten
Schwierig war und ist die Zeit auch für die Kommunionhelferinnen und -helfer: Seit zwei Jahren ist kein regelmäßiger Dienst mehr möglich. Ein Jahr lang konnte von ihnen keine Kommunion ausgeteilt werden. Seit Advent 2021 können den Patienten auf Anfrage hin die Hostien gebracht werden. Von den 15 Helfern, die der Gruppe ursprünglich angehörten, sind 12 übrig geblieben. „Wir haben in einer Whatsapp-Gruppe den Kontakt zueinander gehalten, uns füreinander interessiert und Anteil am Schicksal der anderen genommen“, unterstreicht Resi Heinrichs, die zusammen mit ihrem Ehemann Manfred zu den Pionieren der Gruppe gehört. Die Gründe, warum die ehrenamtliche Kommunionhelfer-Tätigkeit in Corona-Zeiten schwer aufrechtzuerhalten war, liegen für Helena Fothen auf der Hand: „Unsere Freiwilligen sind ältere Leute, zum Teil mit Vorerkrankungen. Dass sie Angst davor haben, in ein Krankenhaus zu gehen, kann ich gut verstehen.“ Außerdem seien manche selbst an Corona erkrankt oder hätten sich um einen Partner kümmern müssen, der erkrankt war.
Resi und Manfred Heinrichs sind überzeugte praktizierende Katholiken, die sich unter anderem im Pfarreirat, im Kirchenvorstand, beim Schützenverein oder beim Pfarrfest engagiert haben oder noch engagieren. Wer sich von ihnen im Linnicher St.-Josef-Krankenhaus die Kommunion bringen lassen will, meldet sich vorher an. „Wenn wir im Krankenzimmer sind, bitten uns aber oft auch Angehörige und andere Patienten, auch solche, die sonst eher kirchenfern sind, darum, ihnen die Krankenkommunion zu geben“, freut sich Resi Heinrichs. „Bei manchen bewegen sich dann die Lippen, und Tränen der Freude rollen über ihr Gesicht. Und ich bin nie diejenige, die irgendjemandem den Herrgott verweigert.“ Manchmal brauche man auch einen Push vom Personal, das nach der Seelsorge rufe. In dem 110-Betten-Krankenhaus wird an einem durchschnittlichen Sonntag nach der Wortgottesfeier 40 bis 50 Mal die Kommunion verteilt.
Auswirkungen einer Covid19-Erkrankung am eigenen Leib erfahren
Kommunionhelfer Manfred Heinrichs, der an Diabetes leidet, hat eine dramatische Krankheitsgeschichte hinter sich. Im Herbst 2020 wurde er über eine längere Zeit hinweg von Magenschmerzen geplagt. So entschloss er sich, im Linnicher Krankenhaus eine Magenspiegelung vornehmen zu lassen. Doch als er am 13. November 2020 das Hospital betrat, eröffnete ihm ein Arzt überraschend, er wolle ihm statt der Magenspiegelung Blut abnehmen. Noch am selben Tag brach Heinrichs zusammen und wurde ins Koma gelegt, das vier Wochen dauern sollte. Das Resultat der Blutabnahme war eindeutig: Heinrichs hatte sich mit Covid-19 infiziert, wurde auf die Intensivstation verlegt und musste beatmet werden. „Die Ärzte versicherten mir: Wir tun unser Bestes für Ihren Mann“, erinnert sich Resi Heinrichs. Der bekam von der Behandlung – es musste sogar ein Luftröhrenschnitt gemacht werden, um ihm das Atmen zu erleichtern – nichts mit und kann sich auch heute an diese schwere Phase nicht erinnern. Als er nach vier Wochen aufwachte und seine Frau vor sich sah, lautete die erste Frage, die er an sie richtete: „Wer sind Sie denn?“ Doch auch wenn sich sein Zustand langsam leicht besserte, schaffte er es lange Zeit nicht allein, bis zur Toilette zu kommen.
Die Krankenschwestern, die den Kommunionhelfer kannten, nahmen an seinem Schicksal großen Anteil und taten alles, was in ihrer Macht stand. Manfred Heinrichs war jedoch noch lange sehr schwach, und es sollte noch Monate dauern, bis er sich von der Erkrankung halbwegs erholt hatte. Heute kann er zwar wieder Treppen steigen, leidet aber noch an Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Erschöpfung. Trotzdem leitet er wieder Wortgottesfeiern in seinem Wohnort Körrenzig und hält Beerdigungen. Das Linnicher Krankenhaus, in dem er bereits in den 50er Jahren tagtäglich als Messdiener tätig war, betrachtet er als seine spirituelle Heimat. „Wenn ich gute Freunde beerdigen muss und Gefahr laufe, selbst emotional zu sehr betroffen zu sein, dann hole ich Manfred Heinrichs als Partner im Beerdigungsdienst dazu“, versichert Helena Fothen.
Und der Krieg in der Ukraine? Ist er aktuell im Krankenhaus ein Thema? „In Gesprächen mit jungen Mitarbeitern kommt das pure Entsetzen hoch, wie so etwas heutzutage möglich ist“, berichtet die Pastoralreferentin. „Da herrscht Fassungslosigkeit. Es wird gefragt, was im Leben etwas wert ist und wohin wir gehen, wenn wir gestorben sind.“ Auch auf den Krankenstationen sei der Krieg das dominierende Thema neben der eigenen Krankheit. Das Mitgefühl mit der Ukraine sei sehr groß, aber auch die Angst vor der Zukunft. „Mich nimmt die Situation sehr mit. Für mich ist das unerträglich“, macht Resi Heinrichs ihren Gefühlen Luft. „Wir leben alle auf einem Pulverfass.“