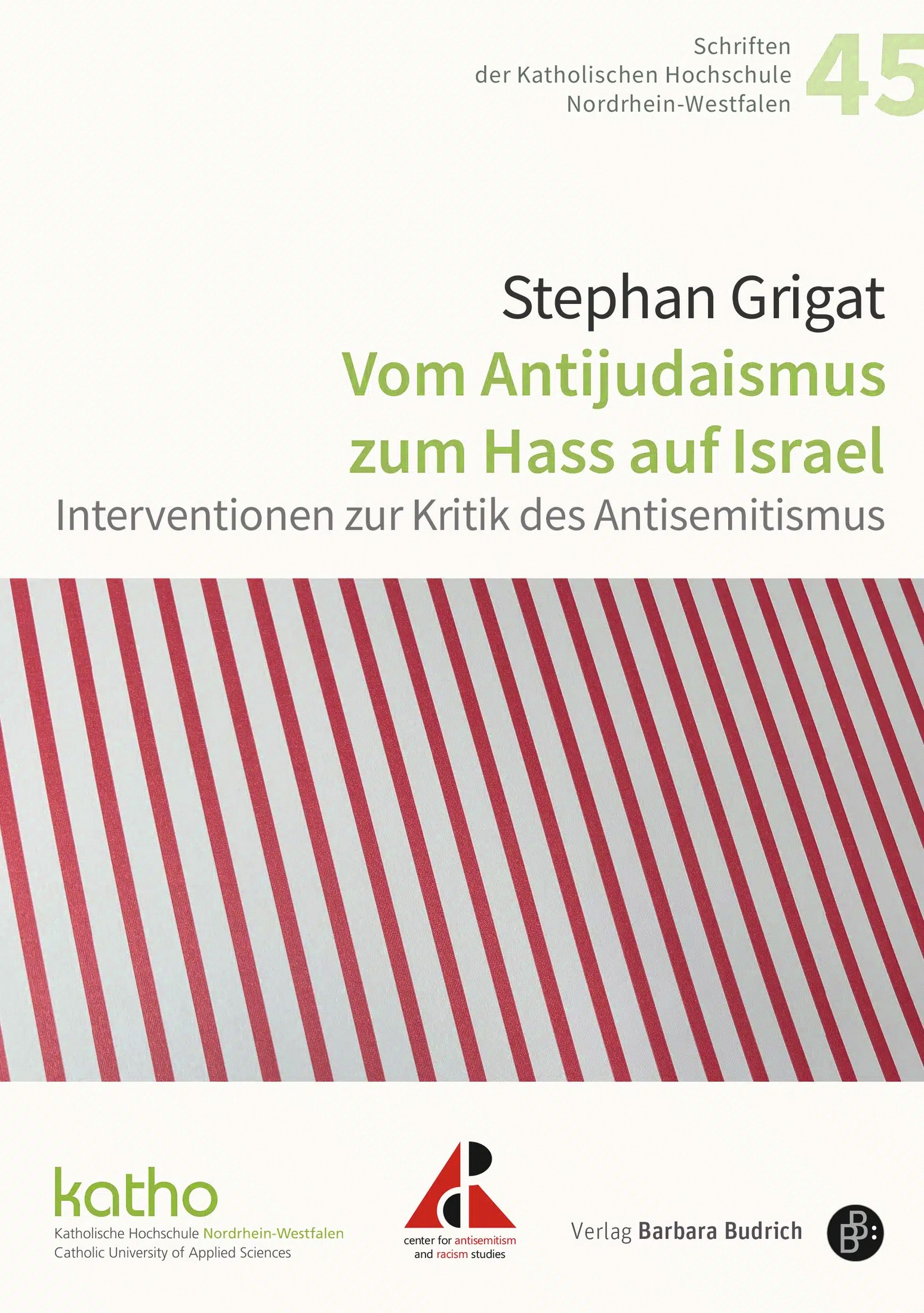Antisemitismus
„Die Rede von der Staatsraison war in vielen Aspekten nur Gerede und billige Rhetorik.“
Stephan Grigat ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus und Leiter des Centrums für Antisemitismus- und Rassismusstudien (CARS) an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Aachen. Wie beurteilt er die Gefahren des Antisemitismus und wie bewertet er die jüngsten Entwicklungen rund um den Krieg zwischen Israel und dem Iran?
Herr Prof. Grigat, was macht Ihr Centrum für Antisemitismus- und Rassismusstudien?
Stephan Grigat: Unser Centrum wurde im Jahr 2020 an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen gegründet, und seit 2022 bin ich dort Professor und Leiter. An unserem Centrum gibt es zwei Besonderheiten: Da ist zum einen unsere sehr explizite Orientierung an der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Im Gegensatz zu einigen anderen Einrichtungen widmen wir uns zum anderen Erscheinungsformen des Antisemitismus, die sonst unterbelichtet bleiben: Formen des israelbezogenen Antisemitismus, Ausprägungen des islamistischen und den Debatten über Antisemitismus in der Linken. Aber selbstverständlich steht auch der traditionelle, vor allem in der politischen Rechten anzutreffende weiterhin im Fokus.
Ist der Antisemitismus für Sie eine Spielart des Rassismus oder etwas unverwechselbar Singuläres, das keiner anderen Größe untergeordnet werden darf? Darüber hat es in jüngster Zeit heftige öffentliche Debatten gegeben.
Grigat: Ich begrüße sehr, dass wir beides, sowohl den Antisemitismus als auch den Rassismus, in unserem Centrum in den Blick nehmen, und zwar in der Tradition einer materialistischen Antisemitismus- und Rassismuskritik. Wir praktizieren eine gesellschafskritisch informierte Rassismuskritik und versuchen die Gemeinsamkeiten von Antisemitismus und Rassismus herauszuarbeiten, zugleich aber auch deutlich zu machen, inwieweit Antisemitismus nicht einfach eine Unterform von Rassismus ist. Beide funktionieren verschieden, aber es gilt, beide zu bekämpfen.
Seit dem 7. Oktober ist die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland exorbitant angestiegen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat gesagt, er erkenne sein Land nicht mehr wieder.
Grigat: Wir beobachten tatsächlich einen sprunghaften Anstieg der antisemitischen Vorfälle und Straftaten, einschließlich physischer Angriffe. Das ist, vor allem durch die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS), mit der wir auf Landes- und Bundesebene kooperieren, gut dokumentiert. Leider hat der 7. Oktober nicht zu einem Erschrecken, zum Innehalten und zur Reflexion geführt, sondern der antisemitische Massenmord der Hamas war eine Art Fanal für eine globale Welle des Antisemitismus in nahezu allen Gesellschaften der Welt. Das ist ein niederschmetterndes Ergebnis.
Was lässt sich gegen Antisemitismus unternehmen?
Grigat: Ich setze einerseits auf Aufklärung, eine Erziehung zur Mündigkeit und den Versuch, die Resistenzkraft im Individuum gegenüber pathischen Projektionen zu stärken, aber ich bin mir anderseits dessen bewusst, dass es Grenzen der Aufklärung gibt. Wo eine Erziehung zur Mündigkeit nicht gelingt, muss man auf gesellschaftlicher und internationaler Ebene klare Grenzen aufzeigen und mit repressiven Mitteln gegen den Antisemitismus vorgehen. Laut einer Formulierung von Adorno gilt es, gegenüber manifestem Antisemitismus Machtmittel „ohne Sentimentalität“ zur Anwendung zu bringen. Ich denke, das muss auch im globalen Maßstab gelten. Auch hinsichtlich des Mullah-Regimes im Iran ist klar: Zureden und Verhandeln reichen nicht, sondern man muss ihm Grenzen aufzeigen, gegebenenfalls auch militärisch.
Ist „Antisemitismus“ überhaupt der richtige Begriff? Oder müsste man von „Judenhass“ sprechen?
Grigat: Das ist eine lange diskutierte Problematik, aber der Antisemitismus-Begriff ist etabliert, auch in Abgrenzung von religiösen Vorformen wie dem Antijudaismus, der häufig mit Antisemitismus gleichgestellt wurde. Aus dem religiösen Judenhass entstand der moderne, rassistische Antisemitismus, und beide bilden die Grundlage für antisemitische Formen des Antizionismus.
Welchen Begriff von Antisemitismus vertreten Sie? Die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus, der sich zuletzt die Linkspartei angeschlossen hat, oder die sonst in Deutschland vertretene Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)?
Grigat: Beide Definitionen können die Sache des Antisemitismus nicht vollständig erfassen, denn eine umfassende Kritik kann man nur im Rahmen einer allgemeinen Gesellschaftskritik formulieren. Die Frage der Definitionen ist mehr eine politische. Die IHRA-Definition halte ich politisch für sehr sinnvoll und empfehle Institutionen, sie zu verwenden. Die Jerusalemer Erklärung ist keine entpolitisierte Form, sondern sie ist eminent politisch. Ihr grundlegendes Problem besteht darin, dass sie sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Persilschein für bestimmte Erscheinungsformen des israelbezogenen Antisemitismus zu formulieren. Insofern sollte man sich nicht wundern, dass Nachrichtenagenturen des antisemitischen iranischen Regimes von dieser Definition begeistert sind. Allein schon deswegen sollte man der Jerusalemer Erklärung mit großer Skepsis begegnen.
Es gibt den linken, den rechtsradikalen und den islamistischen Antisemitismus. Inzwischen scheint der Antisemitismus weit bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen zu sein – oder war nie verschwunden?
Grigat: So ist es, er ist aus der Mitte der Gesellschaft nie verschwunden. In letzter Zeit äußert er sich auch dort vor allem in Ressentiments gegenüber dem jüdischen Staat.
Darf man als Deutscher und Nicht-Jude denn Kritik an der israelischen Regierung üben?
Grigat: Solche Kategorien halte ich bei dieser Debatte für völlig überbewertet, und die permanent erhobene Behauptung, Kritik an Israel sei verboten oder tabuisiert, stimmt schlicht nicht. Parteien, Professoren und Studierende, Liberale, Linke und Rechte kritisieren Israel und behaupten gleichzeitig, man dürfe das nicht. Kritik an Regierungshandeln ist das Normalste der Welt, und gerade innerhalb Israels gibt es eine sehr lebendige und kontroverse Diskussion über die derzeitige Regierung, denn Israel ist eine liberale und pluralistische Gesellschaft. Etwas völlig anderes sind von antisemitischen Ressentiments getriebene Delegitimierungen der israelischen Souveränität und der israelischen Selbstverteidigung – und die finden permanent statt.
Was erwarten Sie in Zukunft von den Kirchen?
Grigat: In der katholischen und evangelischen Kirche gibt es ähnlich kontroverse Diskussionen wie in anderen Institutionen. Ich würde mir eine explizite Kritik an antisemitischen Statements wünschen, zu denen ich auch die Dauerkritik an der Ausübung der militärischen Selbstverteidigung Israels zähle, zumal es in beiden Kirchen bedauerlicherweise eine lange Tradition des Antisemitismus gibt.
Ihr Vortrag „Aufklärung statt Ausgrenzung: Antisemitismus im Fokus“ der RWTH Aachen, in dem Sie kürzlich die Bedrohung Israels durch den Iran in den Mittelpunkt gestellt haben, war geradezu prophetisch, denn zwei Tage danach griffen die USA den Iran an. Wie bewerten Sie die jüngsten Ereignisse?
Grigat: Ich war von den Angriffen auf die iranischen Atomanlagen nicht überrascht. Ich kann nur feststellen, dass die Kritik, die in einigen europäischen Hauptstädten daran geübt wird, verlogen ist. Die europäischen Politiker hätten 30 Jahre Zeit gehabt, alle nicht-militärischen Maßnahmen umzusetzen. Die europäische und deutsche Politik hat stattdessen lieber auf Handel gesetzt und dadurch das iranische Regime in die Lage versetzt, ein solches Atomwaffenprogramm betreiben zu können. Seit 30 Jahren haben israelische Regierungen immer wieder gewarnt und um eine scharfe Sanktionspolitik gebeten – vergeblich. Deswegen hat Israel sich genötigt gesehen, dagegen vorzugehen. Ich halte die Militärschläge gegen die Ajatollah-Diktatur für praktizierte Antisemitismuskritik, denn wir haben es im Iran mit einem antisemitischen Regime zu tun, wodurch das Atomprogramm seine enorme Gefährlichkeit bekommt.
Wie beurteilen Sie die Äußerungen der Bundesregierung dazu? Kanzler Merz hat Israel bescheinigt, es erledige für uns „die Drecksarbeit“ und den US-Angriff auf die Atomanlagen gelobt, während Außenminister Wadephul ihn als „bedauerlich“ bezeichnet hat.
Grigat: Wadephuls Äußerung halte ich für falsch. Ich hätte mir eine deutlichere Unterstützung Israels gewünscht, vor allem aber viel mehr Selbstkritik gegenüber der eigenen Iran-Politik. Immer noch werden Milliardengeschäfte mit dem Iran gemacht, und die Revolutionsgarden sind immer noch nicht auf der Terrorliste.
Wie wird sich der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiterentwickeln?
Grigat: Inwieweit es zu ernsthaften Verhandlungen kommt, lässt sich noch nicht sagen. Das Atomwaffenprogramm ist nicht weg, sondern nur beschädigt und zurückgeworfen. Der Iran wird weiter Uran anreichern, und die Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel werden weitergehen. Es gibt aber auch eine positive Gegenentwicklung: Die iranische „Widerstandsachse“ mit Hamas, Hisbollah und Huthis ist deutlich geschwächt. Außerdem hat sich durch die Abraham-Abkommen inzwischen eine Art Gegenallianz gebildet, der die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrein und Marokko angehören, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben. Auch Saudi-Arabien tendiert in diese Richtung, und dieser Prozess wird vermutlich weitergehen. Dieses positive Gegenmodell ist sehr zu begrüßen, und wir haben in unserem Centrum ein Forschungsprojekt zu den Abraham Accords.
In Ihrem Vortrag an der RWTH haben Sie darauf hingewiesen, dass die Sicherheit Israels, welche die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2008 zum Teil der deutschen Staatsraison erklärt hat, in Wirklichkeit viele Jahre nicht zu dieser Staatsraison gehört hat. War das ein Fehler?
Grigat: Die Rede von der Staatsraison war in vielen Aspekten nur hohles Gerede und billige Rhetorik. Solange die Bundesregierung keine scharfe Sanktionspolitik gegenüber dem Regime im Iran verfolgt, unterstützt sie den schlimmsten Feind des jüdischen Staates. Wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der deutschen Iran-Politik.
Lesenswert
Zur weiteren Lektüre empfiehlt sich: Stephan Grigat, Vom Antijudaismus zum Hass auf Israel – Interventionen zur Kritik des Antisemitismus. Schriften der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Band 45. Verlag Barbara Budrich, Opladen 2025. Auch als E-Book im Open Access: 978-3-8474-3280-7