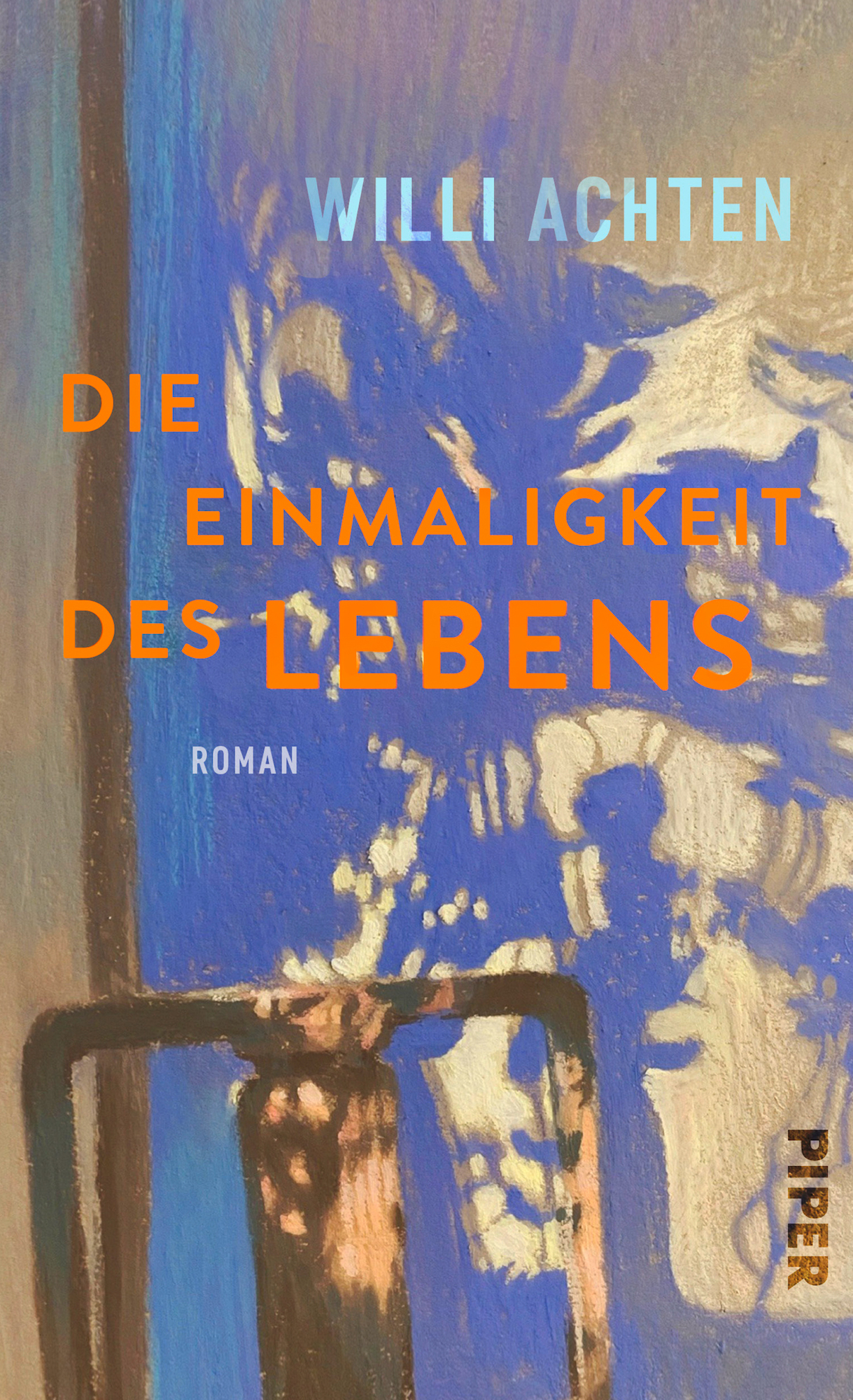"An Karfreitag kannst du nicht einfach so abhauen."
In der dunkelsten Stunde sind Solidarität und Loyalität wichtig. Ein Gespräch über den Tod, Schuldgefühle und die Erkenntnis, was Glück ist.
Selbstverständlich ist Willi Achtens neuer Roman „Die Einmaligkeit des Lebens“ fiktionalisiert; wenn auch die Geschichte der beiden Brüder einen biographischen Hintergrund hat. Der eine, Vinzenz, ist einem Hirntumor hilflos ausgesetzt, der andere, Simon, gefangen zwischen Hilfslosigkeit und Aktionismus. „Es ist sicherlich mein persönlichstes Buch“, sagt Willi Achten, der den Roman seinem verstorbenen Bruder gewidmet hat. Auch das Setting in der Karwoche ist kein Zufall. „Ich wollte Zeugnis ablegen, wie innig die Verbindung war, die über den Tod hinaus bestehen bleibt“, sagt der bei Aachen lebende Autor.
Herr Achten, wird einem die Einmaligkeit des Lebens erst bewusst, wenn das Leben einer geliebten Person plötzlich endet?
Willi Achten: Wir verpassen das Glück ganz oft, weil wir denken, wir wollen jetzt noch glücklicher sein, etwas noch Tolleres erleben. Erst in der Rückschau stellen wir fest, wo wir eigentlich Glück erfahren haben, das manchmal auch verborgen war. In meinem Roman rufe ich das Glück der beiden Brüder in Erinnerung, die sich in dieser Karwoche 1988 ganz nah sind. Diese große Nähe trägt ein Leben lang, über das Ende im Jahr 2017 hinaus.
Im Jahr 2017, der zweiten Zeitebene, erhält in Ihrem Roman Vinzenz eine tödliche Diagnose: Glioblastom. Der bösartigste bekannte Hirntumor, kaum heilbar. Ihr eigener Bruder ist 2022 an einem Hirntumor gestorben. Wie viel Aufarbeitung dieses Verlustes steckt im Buch?
Willi Achten: Ich habe den Roman nicht aus Gründen der Trauerarbeit geschrieben. Aber ich hatte die Idee, darüber zu schreiben, ich wollte meinen Bruder ein Stück bewahren. Es war ein sehr schönes, aber auch intensives Schreiben. Für mich war es spannend zu sehen, wie sich die Geschichte entwickelt. Im Schreiben war ich Vinzenz und meinem Bruder sehr nahe. Wir Menschen brauchen eine Geschichte, müssen mitfiebern, wie es weitergeht, wie es ausgeht, ob es noch gut ausgeht. Gleichzeitig stehen Fragen im Raum, die wir alle kennen: Kann ich denjenigen noch retten? Wie gut habe ich ihm beigestanden? Wie gut kann man das überhaupt? Es sind diese Spannungsmomente und Erfahrungen, die den Roman für viele Menschen so gut lesbar und berührend machen.
Weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass beim Tod eines geliebten Menschen neben Trauer oft auch Schuldgefühle vorherrschen?
Willi Achten: Jeder Tod ist mit einem Schuldgefühl verbunden. Hätte ich die Krankheit verhindern können? Hätte ich den Tumor schon früher bemerken können? Hätte, hätte, hätte. Das Buch handelt ja nicht nur vom Tod. Weil der Ton so warm ist, läuft man nicht weg. Literatur kann, wie Kafka sagt, die Axt für das gefrorene Meer in uns sein. Wir fühlen Schmerz, wir fühlen mit und werden so um ein Leseerlebnis bereichert.
Würden Sie sich als religiösen Menschen bezeichnen?
Willi Achten: Eher religiös als nicht religiös. Ein Ort wie die Kapelle in Elmpt, die ich im Roman beschreibe, ist ein guter Ort für mich. Im Roman rennt Simon, nachdem sein Bruder die Diagnose erhalten hat, dorthin. Er spürt eine Gottverlassenheit, hat sich seit seiner Zeit als Messdiener lange von allem Religiösen entfernt, doch diese uralten Worte leben noch in ihm. Es bricht wieder etwas auf, bietet Anbindung. Er ist voller Zweifel und Angst, nicht fest im Glauben. Aber das ist in unserer abendländischen Kultur ja ganz entscheidend: zu wissen, dass diese Glaubenspraktiken und Glaubenssätze in uns weiterleben. Es ist ja nicht nur Murks, der in der Bibel steht.
Ihr Roman würde ohne die Klammer des Osterfestes nicht so gut funktionieren. Wie definieren Sie Ostern?
Willi Achten: Mir war der Karfreitag immer wichtig, eine dunkle Stunde. An Karfreitag kannst du nicht einfach so abhauen, Chips futtern und vor der Glotze Monumentalfilme schauen. Als Kind bin ich Karfreitag mit meinem Vater in die Kirche gegangen. Es war mir wichtig, solidarisch und loyal zu sein. Was folgt, ist eine schöne Befreiung, das habe ich am tollsten einmal auf Korfu erlebt, wo die Osternacht opulent und ausufernd gefeiert wurde. Als Schriftsteller würde ich hier von einem Spannungsbogen sprechen. In meinem Roman ist der Ostersonntag ausgesetzt. Ein Ostern im Sinne von „Wird alles gut“ ist nicht vorhanden, aber ein „Wir bleiben verbunden – auch über den Tod hinaus“. Ostern funktioniert nicht ohne den Karfreitag, ohne dass jedem Menschen sein eigener Gründonnerstag passiert und er einschläft, wenn es wichtig ist.
Kann auch Ihr Buch helfen, Trauerarbeit zu leisten?
Willi Achten: Die Brüder in meiner Geschichte waren immer sehr eng beieinander. Es ist weder sinnvoll, vor der Trauer wegzulaufen, noch ihr absolut zu verfallen. Ich selbst möchte die Trauer gar nicht verlieren. Das Schreiben war für mich Erinnerungsarbeit. Über die Erinnerung scheinen all die wunderbaren Momente wieder auf. Es ist nicht immer angenehm, aber am Ende sind wir denjenigen, um die wir trauern, viel näher, können sie bewahren. Bewahren geht durch Erinnerung, warme Melancholie. Nicht kalt, nicht grob, nicht hart.
Ohne zu viel verraten zu wollen, spielen die Ereignisse im Garten Gethsemane und der Verrat des Judas an Jesus eine zentrale Rolle im Buch. Ist dies auch ein Ausdruck der Schuldgefühle?
Willi Achten: Ich beschreibe im Buch den Schnitzaltar der Kapelle in Elmpt, der auch diese Szene zeigt. Das ist für die Zeitebene 1988 wichtig, aber auch für 2017, wo Simon im Krankenhaus einschläft – und in der dunkelsten Stunde seinen Bruder Vinzenz im Stich lässt, Schwäche zeigt, anstatt alles mit durchzustehen. Genau das Geschehen im Garten Gethsemane spiegelt sich im Roman wider. Auch die Hilflosigkeit, die im Angesicht einer tödlichen Krankheit oft enorm ist. Ich habe mich immer wieder mit den Ärzten unterhalten, selbst recherchiert, dachte, wir finden etwas, meinen Bruder zu retten. Leugnung und Selbstermächtigung lagen nahe beieinander.
Wie wichtig ist es im Prozess anzuerkennen, dass es keine Hilfe mehr gibt?
Willi Achten: Das ist die finale Katastrophe. Die absolute Wahrheit. Wir können jetzt darüber sprechen, aber wie muss es für denjenigen sein, der diesen Moment erleben muss? Unvorstellbar!
Haben Sie einen Rat an Menschen, die ähnliche Situationen durchleben?
Willi Achten: Habe keine Angst vor Trauer, keine Angst vor dem Schmerz. Bemüh´ dich aber dein ganzes Leben darum, dass die Beziehungen zu denjenigen nah sind, die uns wichtig sind. Nicht gut – das bekommen wir nicht immer hin. Aber nah. Das vergessen wir nämlich oft.
Was bedeutet „nah“?
Willi Achten: Mit wem kannst du wirklich Trauer und Freude teilen? Wenn es zwei, drei Menschen sind, können wir schon froh sein. Die Welt ist geschäftig, schnell haben wir 3000 Freunde auf Facebook. Gleichzeitig lösen sich soziale Institutionen auf, die Kirche löst sich auf, zum Teil selbst verschuldet. Die Verei-ne lösen sich auf. Während Corona ging Gemeinschaft gar nicht mehr, aber wir müssen auch jetzt mehr dafür tun, dass wir Gemeinschaften erhalten, Familien erhalten.
Was hat sich verändert in der Welt?
Willi Achten: Was macht Zusammenhalt schwer? Mit Enttäuschungen und Kränkungen umzugehen. Ignoranz zu begegnen. Das birgt Enttäuschung, und wir wollen nicht dauernd Enttäuschung erfahren. Und wie weit ist Empathie bei Menschen noch ausgebildet? Die Zeit heute glaubt immer an eine Verfügbarkeit von allem. Glück, Gesundheit und Verfügbarkeit von guten, engen Beziehungen. Glück, Liebe und Beziehungen sind aber nicht immer verfügbar, sondern manchmal ein Geschenk. Sie brauchen Einsatz, Loyalität.
Loyalität ist also die Tugend der Stunde?
Willi Achten: Wenn wir die Loyalität aufkündigen, schwächen wir die Demokratie. Wir schwächen die Institutionen, die Freundschaften, stürzen in eine Vereinsamung und Verrohung. Trump, Putin, Erdogan – das sind beinahe archaische Personifizierungen des Bösen, deren Politik von tiefster Unmenschlichkeit geprägt ist. Und das sind nur die größten Despoten. Es war einmal unvorstellbar, dass das Asoziale, das Unmenschliche, in der Politik wieder hoffähig ist. Nun wird es auch gesellschaftlich immer hoffähiger. Dem müssen wir uns entgegenstellen.
Beunruhigt es Sie als Schriftsteller, dass in den USA Teile der Archive gelöscht werden?
Willi Achten: Als Schriftsteller bin ich nicht unbedingt der Realität verpflichtet, wohl aber der Wahrheit. An vielen Stellen erleben wir eine Klitterung der Geschichte, eine Verdrehung von Wahrheiten. Archive werden verändert und damit historische und politische Fakten.
Zur Person
Willi Achten wuchs in einem Dorf am Niederrhein auf, studierte in Bonn und Köln und lebt heute im niederländischen Vaals. Der Lehrer für Sonderpädagogik ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seit den 1990er-Jahren ist er schriftstellerisch tätig, bei Piper erschien jüngst sein Roman „Die Einmaligkeit des Lebens“ (ISBN 978-3-492-07285-4, 224 Seiten, 24 Euro). Zuvor erschienen im gleichen Verlag seine Romane „Die wir liebten“ und „Rückkehr“. Einmal pro Woche leitet er ein Verhaltenstraining an einer Aachener Schule und vermittelt Kindern und Jugendlichen, auch in Konflikten cool zu bleiben. Auf dem Fußballplatz wird das Erlernte gleich dem Praxistest unterzogen.